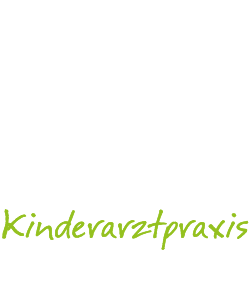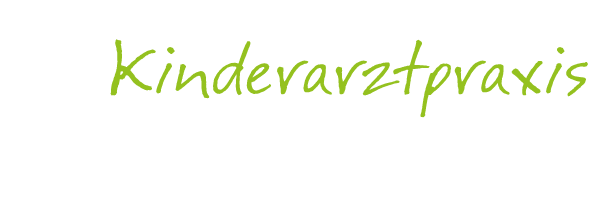Tipps
1. Fieber ist keine Krankheit, sondern ein Zeichen dafür, dass sich der Körper Ihres Kindes mit einer Erkrankung auseinander setzt.
2. Fieber liegt vor, wenn die Körpertemperatur Ihres Kindes über 38,5° Celsius liegt.
3. Fieber sollte im After gemessen werden. Notieren Sie sich die gemessene Temperatur mit Angabe der Uhrzeit. Wehrt sich Ihr Kind gegen die Messung im After, können Sie die Temperatur im Mund oder mit einem Ohrthermometer im Ohr messen.
4. Bei Fieber sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind behaglich warm, aber nicht zu warm angezogen ist.
5. Fiebernde Kinder haben häufig weniger Appetit, sie sollten aber viel trinken. Bieten Sie vermehrt verdünnte Fruchtsäfte, Wasser oder Tee an.
6. Hohe Temperaturen (über 39,5°) sind beim Kind nichts Ungewöhnliches. Fühlt sich Ihr Kind dabei wohl und spielt, braucht es kein Bettaufenthalt. Kurze und ruhige Aufenthalte sind erlaubt.
7. Bei Fieber mit warmen Beinen können zur Temperaturregulierung kühlende Beinwickel gemacht werden. Diese können in 10-minütigen Abständen mit Brustwickeln abgewechselt werden. Beine und Brust dürfen nicht auskühlen.
8. Ein Fiebermedikament in Form von Zäpfchen oder Saft, sollten Sie erst ab 39,5° geben, oder wenn Ihr Kind unruhig und unleidig ist, oder nicht schlafen kann.
9. Ein Fieberkind können Sie jederzeit gefahrlos transportieren.
10. Bei Fieber mit Infektzeichen informieren Sie frühzeitig Ihren Arzt. Infektzeichen sind:
- Erbrechen
- Durchfall
- Schnupfen
- Husten
- Schmerzen aller Art
- Ausschläge der Haut
11. Ein Fieberverlauf ist bedrohlich:
- wenn Ihr Kind jede Nahrung, vor allem Flüssigkeit, verweigert oder alles erbricht und massive Durchfälle hat;
- wenn das Fieber auf Wickeltherapie oder ein Fiebermedikament überhaupt nicht anspricht;
- bei ständig hohen Temperaturen über 40° und wenn Ihr Kind immer ruhiger und apathisch reagiert;
- bei starken Kopf- und Nackenschmerzen und Bewusstseinstrübung;
- bei Fieberkrampf